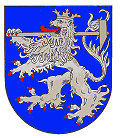Der Alte Turm aus dem frühen 14. Jahrhundert ist das älteste
Gebäude Dudweilers. Neben dem Turm selbst sind auch noch Reste der alten Kirchhofsmauer
erhalten (die aber wohl früher höher war als heute). Einige der dachförmigen Decksteine
weisen deutlich sichtbare "Wetzrillen" auf, deren ursprüngliche Bedeutung noch nicht
eindeutig geklärt ist. Bei Jüngst-Kipper und Jüngst (1990) finden sich hierzu folgende
Ausführungen
Der Alte Turm aus dem frühen 14. Jahrhundert ist das älteste
Gebäude Dudweilers. Neben dem Turm selbst sind auch noch Reste der alten Kirchhofsmauer
erhalten (die aber wohl früher höher war als heute). Einige der dachförmigen Decksteine
weisen deutlich sichtbare "Wetzrillen" auf, deren ursprüngliche Bedeutung noch nicht
eindeutig geklärt ist. Bei Jüngst-Kipper und Jüngst (1990) finden sich hierzu folgende
Ausführungen
Erhalten sind aber noch die dachförmigen Decksteine der alten Mauer. Auf ihrer Oberseite
finden sich heute noch zahlreiche sogenannte "Wetzrillen", Spuren eines oder
mehrerer, noch nicht restlos geklärter Bräuche. Solche Wetzrillen gibt es meist an
Kirchenportalen, Burgtoren und an Kirchhofmauern. Die für uns einleuchtendste
Deutung bietet Rug [1983]. Danach sind es Spuren eines symbolischen Rituals des
Frieden-Gebietens. Bis zum Ausgang des Mittelalters trug auch der einfache Mann,
wenn er über Land ging, den Gottesdienst besuchte oder zum Tanzen und Feiern ging,
wie auch zum Gerichtstag - ob Hoch- oder Dorfgericht - seine Seitenwaffe. Wenn er
nun einen kirchlichen Raum betrat, wo Gottesfriede geboten war, oder ein
Gerichtsareal, wo Landfriede geboten war, so fuhr er mit der Waffe durch eine
solche Rille zum Zeichen, daß für diesen Ort und diese Zeit seine Wehr stumpf
sein solle. Daß man sich nur symbolisch entwaffnete, kann mit einer ständig
gebotenen Verteidigungsbereitschaft auch in solchen wehrhaften Kirchen zusammenhängen.
Diese Deutung schließt nicht aus, daß beim Verlassen des befriedeten Bezirks die
Waffen wieder - und dies nun nicht nur symbolisch sondern tatsächlich -
geschärft wurden.
(Jüngst-Kipper & Jüngst, 1990, S. 21)
(Jüngst-Kipper & Jüngst, 1990, S. 21)
Andere Deutungen von Wetzrillen finden sich zum Beispiel auf dieser Fragen-und-Anworten-Seite. Jan Selmer, der Betreiber jener hoch interessanten Webseite hat uns zum Thema Wetzrillen folgendes mitgeteilt:
Vielen Dank für die Mitteilung.
Der Deutungsversuch und auch der Artikel von Rug ist mir bekannt. Ich halte ihn jedoch für sehr unwahrscheinlich, denn die Innenseite der meisten Wetzrillen ist in einer Art glattgeschliffen, um nicht zu sagen poliert, wie es m.E. kaum mit einer eine Klinge gelingen würde. Außerdem spricht auch die Form der meisten Wetzrillen und -näpfe an Mauerwerk gegen diese Möglichkeit (zu kurz und tief). Die Wetzrillen kommen auch an vielen Profanbauten vor. Wozu sollte man etwa an der Innenseite der Nürnberger Stadtmauer oder am Pranger und Rathaus in Alsfeld seine Klinge entschärfen? Weitere Beispiele für Profanbauten: Marksburg, Juleum, und auch außerhalb des christl. Kulturkreises: Luxortempel, Menhire...
Einige mir bislang bekannte Deutungsvarianten: Schärfen bzw. Entschärfen von Waffen (Näpfe: durch Drehen von Speer, Pfeil- und Hellebardenspitzen), Gewinnung von Steinmehl zum Schutz gg. Krankheiten, bösen Blick etc., gemeinsames Kerbenschlagen nach Hochzeiten durch Mitglieder der beiden beteiligten Familien, Entzünden des Osterfeuers durch rotierende Holzscheiben, Zuspitzen von Schreibgriffeln, Bußübungen (Drehen des Fingernagels bis es ordentlich schmerzt) bzw. Reiben des Fingernagels in Näpfchen durch stolze Väter nach der Geburt usw.
Letztlich scheint es sich um einen Brauch zu handeln, der in der frühen Neuzeit (ich schätze mal etwa im späten 16. / frühen 17. Jh.) in Vergessenheit geriet, vorher aber so gewöhnlich bzw. banal war, daß es niemand für nötig hielt, darüber auch nur einen Satz niederzuschreiben...
Beste Grüße, Jan Selmer.
(email vom 29. April 2003 j.selmer@zeitensprung.de)
Der Deutungsversuch und auch der Artikel von Rug ist mir bekannt. Ich halte ihn jedoch für sehr unwahrscheinlich, denn die Innenseite der meisten Wetzrillen ist in einer Art glattgeschliffen, um nicht zu sagen poliert, wie es m.E. kaum mit einer eine Klinge gelingen würde. Außerdem spricht auch die Form der meisten Wetzrillen und -näpfe an Mauerwerk gegen diese Möglichkeit (zu kurz und tief). Die Wetzrillen kommen auch an vielen Profanbauten vor. Wozu sollte man etwa an der Innenseite der Nürnberger Stadtmauer oder am Pranger und Rathaus in Alsfeld seine Klinge entschärfen? Weitere Beispiele für Profanbauten: Marksburg, Juleum, und auch außerhalb des christl. Kulturkreises: Luxortempel, Menhire...
Einige mir bislang bekannte Deutungsvarianten: Schärfen bzw. Entschärfen von Waffen (Näpfe: durch Drehen von Speer, Pfeil- und Hellebardenspitzen), Gewinnung von Steinmehl zum Schutz gg. Krankheiten, bösen Blick etc., gemeinsames Kerbenschlagen nach Hochzeiten durch Mitglieder der beiden beteiligten Familien, Entzünden des Osterfeuers durch rotierende Holzscheiben, Zuspitzen von Schreibgriffeln, Bußübungen (Drehen des Fingernagels bis es ordentlich schmerzt) bzw. Reiben des Fingernagels in Näpfchen durch stolze Väter nach der Geburt usw.
Letztlich scheint es sich um einen Brauch zu handeln, der in der frühen Neuzeit (ich schätze mal etwa im späten 16. / frühen 17. Jh.) in Vergessenheit geriet, vorher aber so gewöhnlich bzw. banal war, daß es niemand für nötig hielt, darüber auch nur einen Satz niederzuschreiben...
Beste Grüße, Jan Selmer.
(email vom 29. April 2003 j.selmer@zeitensprung.de)