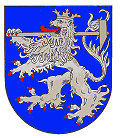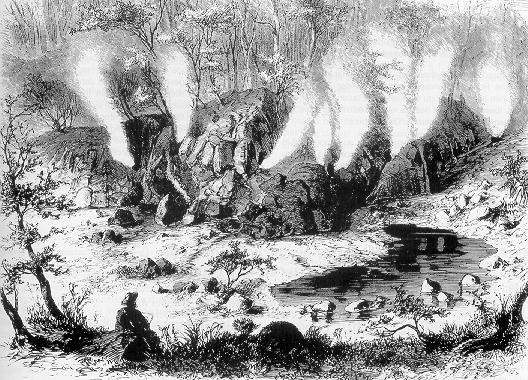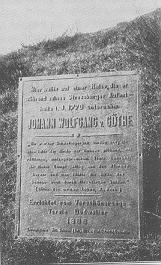Im Norden der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken findet
sich im Sulzbachtal zwischen dem Stadtbezirk Dudweiler und der
angrenzenden Gemeinde Sulzbach ein eindrucksvolles
Naturschauspiel, das schon den Dichterfürsten
Johann
Wolfgang von Goethe fasziniert hatte:
der Brennende Berg.
Im Innern des Brennendes Berges befindet sich ein
in Brand
geratenes Kohleflöz, das seit mehr als 200 Jahren still vor sich hin
kokelt, und dessen Rauchschwaden aus den
Bergspalten austreten. Wenn man an eine Bergspalte heran tritt und die Hand
in den austretenden Dampf hält, kann man sich durchaus die Finger verbrennen.
Die Intensität ist allerdings heute wesentlich
geringer als noch vor einigen Jahrzehnten. Damals, so wird berichtet, brachten
Kinder bei Schulausflügen Eier mit, um sie in dem heißen
Qualm zu sieden.
Naherholungsgebiet Brennender Berg
Der Brennende Berg ist der "Brennpunkt" eines Naherholungsgebietes, das im
Rahmen des Projekts Urban II von der Europäischen Union (EU) gefördert
wird. Im Rahmen erster Sanierungsarbeiten, die im Juli 2002 begonnen und
im Januar 2003 abgeschlossen wurden, wurde
die Zugänglichkeit zu dieser Sehenswürdigkeit deutlich verbessert.
Die ehemals verschlammten Wege sind begehbar, keine Pfütze hindert den
Literatur- und Naturfreund mehr, ganz nahe an jenen Felsspalt heranzutreten,
aus dem Goethe vor über 200 Jahren ein "schwefelartiger Geruch" entgegen
wehte ... "Früher war hier alles voller Schlamm", erklärte
Projektleiter Martin Derow auf dem Platz vor dem Denkmal, das an den Besuch
Goethes erinnert. Denn der Boden, so Derow, bildete hier eine Art Kessel, in
dem sich das Wasser staute, wodurch Fußgänger den Platz kaum
betreten konnten. "Wir haben den Boden komplett abgetragen und mit einem
unsichtbaren Entwässerungssystem trockengelegt", so Derow. Bei der
Wiederherstellung des Platzes und der Wege seien "Materialien aus der Region"
verwendet worden, die sich "optisch gut in den Wald einfügen".
Auch das Holz für die Treppe, über die der Denkmalplatz von
Sulzbach aus zu errreichen ist, stammt aus dem Sulzbacher Wald. Ziel sei es,
so Derow, "touristische Aspekte ebenso zu berücksichtigen wie die
Interessen von Forst und Naturschutz".
Der
Ausbau
des Naturdenkmals Brennender Berg im Rahmen des Urban II
Projektes soll 2006 abgeschlossen werden. Dabei sollen zahlreiche
kulturhistorisch und industriegeschichtlich bedeutsame Stätten,
die sich in unmittelbarer Umgebung
befinden, integriert werden. Dazu gehört zum Beispiel der unterhalb
des Brennenden Berges gelegene ehemalige Gegenortschacht auf dessen
Gelände sich eine der schönsten Direktorenvillen des
saarländischen Bergbaus befindet. Die nahe gelegene
ehemalige Grube Hirschbach soll ebenso eingebunden werden wie die
im Wald gelegenen so genannten Pingefelder, den Überresten aus
der Zeit, in der die Kohlenflöze noch an der
Oberfläche abgebaut werden konnten. Außerdem
soll ein "Fledermausweg" angelegt werden, indem ehemalige Bunker als
Rückzugs- und Habitatstellen für verschiedene Fledermausarten
hergerichtet und mit Fußwegen verknüpft werden.
Insgesamt soll durch eine behutsame
Integration von naturgeschichtlich, kulturgeschichtlich und industriegeschichtlich
bedeutsamen Stätten, welche auf die Belange des Umweltschutzes und des
Naturschutzes Rücksicht nimmt, die touristische Attraktivität der Region
erheblich gesteigert werden.
Johann Wolfgang von Goethe und der Brennende Berg
Im Jahre 1770 weilte Johann Wolfgang von Goethe im elsässischen
Straßburg. Von dort aus unternahm er verschiedene Ausflüge.
In Juni 1770 besuchte er auch die reichen Steinkohlegruben und
die Eisen- und
Alaunwerke in Dudweiler. Bei dieser Gelegenheit
besichtigte er auch den Brennenden Berg. Seine Eindrücke über
dieses Naturschauspiel schildert er in seinem bedeutsamen Werk
Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit
, das 1811 bei Cotta erschien (Zweiter Teil, zehntes Buch).

Wir hörten von den reichen Dutweiler Steinkohlegruben, von Eisen- und Alaunwerken,
ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der
Nähe zu beschauen ... Unser Weg ging nunmehr an den Rinnen hinauf, in
welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen
vorbei, den sie die 'Landgrube' nennen, woraus die beühmten Dutweiler
Steinkohlen gezogen werden ... Nun gelangten wir zu offenen Gruben, in
welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt wurden, und bald darauf
überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegnis.
Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region
des brennenden Berges.
Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Hohle war nahezu
glühend, mit rötlichem, weißgebranntem Stein bedeckt; ein
dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die Hitze des
Bodens auch durch die starken Sohlen. Ein so zufälliges Ereignis, denn man
weiß nicht, wie diese Strecke sich entzündete, gewährt der Alaunfabrik
großen Vorteil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges besteht,
vollkommen geröstet daligen und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürfen.
Die ganze Klamme war entstanden, dass
man nach und nach die kalzinierten Schiefer abgeräumt und verbraucht
hatte. Wir kletterten aus dieser Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des
Berges. Ein anmutiger Buchenwald umgab den Platz, der auf die Hohle folgte
und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon
verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch,
jene Glut nicht ahndeten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend
näherte. Auf dem Platze dampften
verschiedene Öffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm
dieses Feuer bereits zehen Jahre durch alte verbrochene Stollen und
Schächte, mit welchem der Berg unterminiert ist.
Zur Entstehung des Bergbrandes:
1668 sollen nach einer sagenhaft anmutenden Überlieferung durch
das Übergreifen eines Hirtenfeuers auf die den Berg durchziehenden
Kohlenflöze Schwelbrände entstanden sein. Wahrscheinlicher aber ist eine
Selbstentzündung durch Druck und Zersetzung umfangreicher Haldenbestände,
die infolge der damaligen "wilden Kohlengräberei" sich anhäuften.
Durch die Ausdehnung des Haldenbrandes auf das dort zutage tretende
Hauptflöz der Landgrube (Flöz Blücher) zog sich der unterirdische Brand von
der Dudweiler Seite während eines Zeitraums von mehr als hundert Jahren
über den Berg in Richtung Neuweiler. Anfängliche Löschversuche mit
Wasser hatten einen gegenteiligen Erfolg, und nachdem die Alaungewinnung
begonnen hatte, war man sogar auf Erhaltung und Lenkung des unterirdischen
Feuers bedacht. Aber auch diese Unternehmungen waren erfolglos. Bis in die
Mitte des 18. Jahrhunderts waren Glut und Rauchentwicklung so stark,
daß der Name brennender Berg seine Berechtigung hatte, aber bereits 1777 wird
in einem zeitgenössischen Bericht von einem Abflauen des Brands berichtet;
eine offene Flamme war übrigens nie zu sehen, wohl aber durch Spalten und
Runsen die Glut des schwelenden Flözes. Durch den Brand wurden die
hangenden Tonschiefer mit ihren kohligen Bestandteilen einem Röstungsprozeß
unterworfen, der die Grundlage für die Alaungewinnung bildete.
Quelle: Schuto, M. (1977). Neue Wirtschaftszweige - Alaunhütten,
Kokserzeugung, Sudhaus. In: Dudweiler 977 - 1977. Hrsg.: Landeshauptstadt
Saarbrücken Stadtbezirk Dudweiler. Saarbrücker Zeitung Verlag,
Saarbrücken, 1977, S.228.
Alaun: Aus dem Lateinischen alumen. Doppelsulfat, ursprünglich nur für
Kalialaun gebraucht. Salz, das schon den alten Ägyptern bekannt war. Findet
Verwendung als blutstillendes Mittel (Alaunstift), in der Gärberei und
Färberei als Beizmittel, in der Papierfabrikation als Leimmittel (nach
dtv-Brockhaus-Lexikon).
In Dudweiler bestanden 1728 zwei Alaunwerke, die jährlich über 600
Zentner Alaun lieferten, das zu Herstellung von Farben und Salmiak genutzt wurde.
1765 ließ Fürst Wilhelm Heinrich für 21.000 Gulden ein neues
Alaunwerk errichten.
Quelle: Dudweiler 977-1977. Hrsg.: Landeshauptstadt
Saarbrücken Stadtbezirk Dudweiler. Saarbrücker Zeitung Verlag,
Saarbrücken, 1977, S.486.
Quellen